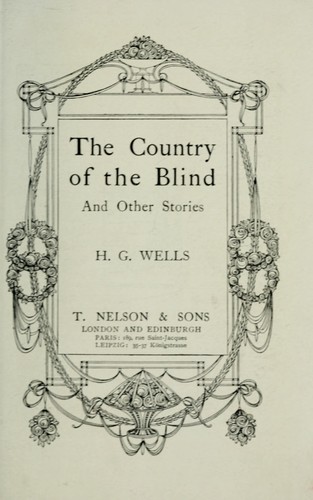Die Dänen waren schon immer eine stolze Seefahrernation. Man identifiziert sich heute noch gern mit den Wikingern, wenn auch mit einer leicht verbrämten Version, die eher auf Tourismus und Geschäfte aus war als auf Brandschatzen und Morden. Das hat zur Folge, dass man hier gern Bötchen fährt, und meine Nachbarschaft, das alte Fischerhafenareal, ist voll von kleinen und mittelgroßen Segelclubs. Mit den edlen Yachtclubs südlicher Gefilde scheinen die wenig zu tun zu haben; von außen wirken sie sehr rustikal und haben am ehesten Festzeltatmosphäre. Man trinkt hier gern mal ein Bier vorm Segeln, eins beim Segeln, und eins nach dem Segeln, nehme ich an. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden.
Die Dänen waren schon immer eine stolze Seefahrernation. Man identifiziert sich heute noch gern mit den Wikingern, wenn auch mit einer leicht verbrämten Version, die eher auf Tourismus und Geschäfte aus war als auf Brandschatzen und Morden. Das hat zur Folge, dass man hier gern Bötchen fährt, und meine Nachbarschaft, das alte Fischerhafenareal, ist voll von kleinen und mittelgroßen Segelclubs. Mit den edlen Yachtclubs südlicher Gefilde scheinen die wenig zu tun zu haben; von außen wirken sie sehr rustikal und haben am ehesten Festzeltatmosphäre. Man trinkt hier gern mal ein Bier vorm Segeln, eins beim Segeln, und eins nach dem Segeln, nehme ich an. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden.Interessant finde ich daran im Moment (auf eine zugegebenermaßen schadenfrohe Weise) hauptsächlich, welche Probleme mit Wasser eine Gesellschaft haben kann, obwohl sie daran und sozusagen darauf aufgebaut ist. Regenwasser überfordert hier beispielsweise recht schnell die Kanalisation. Nach den Regengüssen im August und September haben wochenlang Pumpen und Naßstaubsauger in unserer Waschküche residiert, eine kleine hydraulische Spezialeinheit, die täglich auf ihren Einsatz gewartet haben. Dass man zum Kellerauspumpen Feuerwehrschläuche verwenden kann, ist mir schon klar; trotzdem haben spätestens die mich ein bisschen unangenehmer berührt. Natürlich ist es immer schön trocken geblieben, während das Zeug im Weg herumstand. Ich frage mich, wo die Sachen jetzt untergebracht sind - hoffentlich nicht zu weit weg, denn dann steht uns sonst bestimmt demnächst eine Sturmflut ins Haus.
Wasser im Haus haben wir auch auf der Uni bisweilen, und zwar sozusagen hausgemacht. Vor einer Weile ist unser Brandmeldersystem überarbeitet worden, und seitdem hatten wir schon eine ganze Reihe von falschen Feueralarmen. Besonders schön war es, als letzte Woche völlig unprovoziert die Sprinkler im Atrium losgingen und dort Esstische und Sofaecken überflutet haben. Da so etwas immer ein Nachspiel hat, gibt es morgen einen angekündigten Feueralarm. Wir haben uns alle schon darauf verständigt, keine private Elektronik mit zur Uni zu bringen, falls es plötzlich im ganzen Gebäude zu regnen anfängt. Gelöschtes Kind scheut das Wasser, sozusagen.
 Der Punkt, über den ich mich aber wirklich amüsiert habe, war dann der sozusagen umgekehrte. Der Geschirrspüler in unserer Kaffeeküche hat nämlich seit einer ganzen Weile schon den Dienst verweigert. Die Kollegen von der Haustechnik haben sich das auch ein paar Mal angesehen und uns immer versichert - in sehr freundlichen Worten - dass wir eben ungeschickte, lebensunfähige Akademiker wären und das Gerät einfach nicht richtig bedienen würden. Heute war dann wieder einer von den Haustechnikern da, und ich habe mir erlaubt, einfach mal neben ihm stehen zu bleiben und zuzuschauen, wie er mit der Reparatur vorgeht. Irgendwann ist ihm dann auch aufgefallen, dass an dem Gerät die Wasserzufuhr-Leuchte geblinkt hat. Natürlich war die Lösung ganz einfach, bis das Abspülen des Ablauf-Siebs nicht gebracht hat, und der Kollege etwas stiller wurde. In der nächsten Stunde ist er dann noch ein halbes Dutzend mal an meinem Büro vorbeigetigert, mal in die Bedienungsanleitung vertieft, mal aufgeregt telefonierend, dann mit einem großen Werkzeuggürtel ...
Der Punkt, über den ich mich aber wirklich amüsiert habe, war dann der sozusagen umgekehrte. Der Geschirrspüler in unserer Kaffeeküche hat nämlich seit einer ganzen Weile schon den Dienst verweigert. Die Kollegen von der Haustechnik haben sich das auch ein paar Mal angesehen und uns immer versichert - in sehr freundlichen Worten - dass wir eben ungeschickte, lebensunfähige Akademiker wären und das Gerät einfach nicht richtig bedienen würden. Heute war dann wieder einer von den Haustechnikern da, und ich habe mir erlaubt, einfach mal neben ihm stehen zu bleiben und zuzuschauen, wie er mit der Reparatur vorgeht. Irgendwann ist ihm dann auch aufgefallen, dass an dem Gerät die Wasserzufuhr-Leuchte geblinkt hat. Natürlich war die Lösung ganz einfach, bis das Abspülen des Ablauf-Siebs nicht gebracht hat, und der Kollege etwas stiller wurde. In der nächsten Stunde ist er dann noch ein halbes Dutzend mal an meinem Büro vorbeigetigert, mal in die Bedienungsanleitung vertieft, mal aufgeregt telefonierend, dann mit einem großen Werkzeuggürtel ...Es sieht aus, als wäre jetzt wieder alles im Lot mit zu viel oder zu wenig Wasser im Büro. Wenn die furchtlosen Seefahrer damals genauso mit Wasser umgegangen wären, hätten sie aber wahrscheinlich eher Schwimmwesten als Kettenhemden getragen. Die Zeiten ändern sich eben.